Präzisions Digital- Analogwandler für den Mikroprozessor
od. DA-Umsetzer, bsp. f. eine Applikation m. Operationsverstärker
TL062(Texas-Instr.)
Abb. 1.1
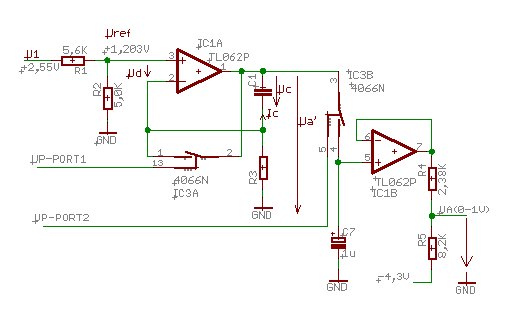
Abb. 1.1 zeigt eine Schaltung eines Wandlers mit zwei Operationsverstärkern
und
Analogschaltern, welche über zwei Ports des Mikroprozessors
angesteuert werden.
Am Ausgang des Integrators erhält man eine
der Zeit proportionale Sägezahnspannung.
Dem Integrator ist eine
Abtast- Halteschaltung sowie eine Pegelanpassung nachgeschaltet.
Mittels
des uP-Ports 1 ist der Kondensator C1 zunächst entladen und wird
dann durch
Umschalten von einem konstanten Strom
ic=(Uref-Ud )/R3
geladen. Mit der Abschätzung für Ud = 0V u. R3>R2 läßt
sich die u.g Gleichung
vereinfachen. Der Strom durch den Kondensator
wird dann durch den Differenzalquozient
beschrieben
ic=C1*dUc/dt
Als Integationszeit Ti für die Ausgangsspannung ergibt sich
ic*ti=C1*Uc > Ti=R3*C1 (Integrierzeit Bsp. 470K*0,1uF)
Innerhalb der Zeit Ti kann nunmehr
am uP-Port2 der Abtastimp. dt variiert bzw. verzögert
werden.
Die Dauer des Abtastimpuls zum Laden des Haltekondesators bestimmt man über
den Innenwiderstand des IC1A sowie des Analogschalters. Der Lieferstrom
des Operation-
vertärkers beträgt hierfür max. 20mA,
so daß der Haltekondesators C7 möglichst während
eines
Abtastimpuses geladen werden kann. Einen Spannungsabfall über dem Analogschalter
sollte man daher berücksichtigen. Der Spannungsteiler am Eingang
läßt sich sehr einfach
beschreiben, wobei K1=2,55V/Ub,
K2 = R2/(R1+R2) und somit Uref=K1*K2*Ub
(Ub=Speisesp.) Die Ausgangsspannung
des Operationsverstärkers IC-1A ist.
Ua' =Uc+(Uref-Ud) mit Ud=0
dann entsprechend dem Zeitintegral
t2
t2
Ua'= 1/C1 | ic*dt + Uref > Ua' = 1/Ti | Uref*dt + Uref
t1
t1
Am Spannungsteiler R4, R5 wird nunmehr die Spannung Uref wieder
subtrahiert, so daß
sich die Spannung aus dem Produkt der
Referenzspannung (Uref) dem Widerstands-
verhältnis (K3) und dem
Zeitverhältnis ergibt
Ua = Uref* K3 *dt/Ti
Da Uref, K3 und Ti konstant ist, wird die Ausgangsspannung proportional
zum
Abtastzeitpunkt
Ua ~ dt.
Die benötigten Spannungen für die Referenz lassen sich, wie
in Abb. 1.2 dargestellt,
erzeugen.
Abb. 1.2
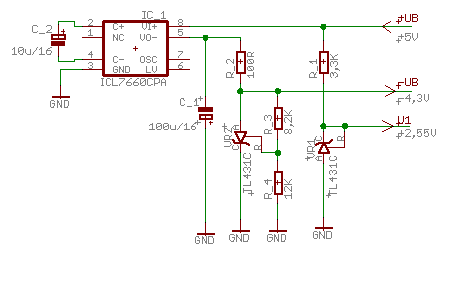
Eine Möglichkeit einen D/A-Wandler mit nur einem Port
des uP zu bewerkstelligen
erfordert eine zusätzliche Schaltung,
wobei die Steuerung über Port1,2 entfällt und ist
in Abb.
2.1 dargestellt. Bei dieser Schaltung wird ebenfalls mittels des Zeitverhältnisses
dt/T die Ausgangsspannung eingestellt. Mit der ersten Kippstufe werden
die Zeiten
verlängert, wobei die Signalflanke mittels des Schmitt-Triggers
bereinigt wird. Man
könnte hierfür auch eine andere Beschaltung
benützen. Wichtig ist, das bei halber
Speisespannung keine Signalverzerrungen
auftreten, damit die nachfolgenden C-MOS
Schaltungen bestens funktionieren.
Mit der zweiten Kippstufe wird dann, bei der
entsprechenden fallenden
Flanke, der augenblickliche Spannungswert, übernommen.
Damit können
dann Pulslängen oder Pulsbreiten ausgewertet werden. Das läßt
sich
natürlich auch mit einem IC4098, wie in der Abb. 2.2, realisieren.
Abb. 2.1
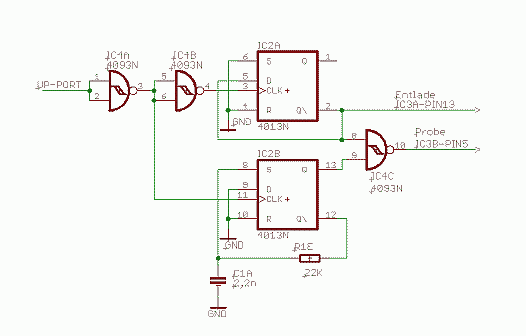
Abb. 2.2
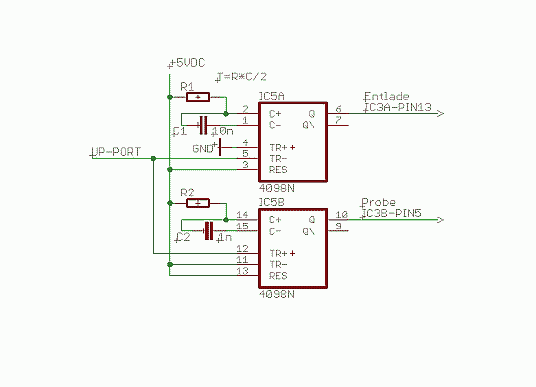
Zu einer einfacheren Umwandlung gelangt man, wenn man einen uP mit integriertem
Puls-
breitenmodulator verwendet, wie den Mega8 von Atmel. Dessen Portsignal
läßt sich mittels
eines Tiefpaß Abb. 3.1 in
eine Gleichspannung umformen, wenn die Zeitkonstante
(T=R*C) hinreichend
größer ist als die Periodendauer (tp=te+ta). Diese RC-Kombination
wird auch als Integrierglied bezeichnet. Man erreicht mit diesem einf.
Tiefpaß-Schaltung
keine gute Glättung des Signals, da die
Ausgangspannung nach dem Einschwingen immer
um den stationären
Zustand pendelt Abb. 3.2 Beispielsweise sei T=10*tp, Spannung =5V,
und das Zeitverhältnis te=ta= 0,5*tp dann ist ut1l=ut0*(1-e(-te/T)=5V*(1-0,951)=
0,243V
Von diesem Momentanwert dann Entladen ut1e=ut1l*(e(-ta/T)=ut1l*0,951=0,232
ergibt
die Restspannung ut2l=ut1e+((ut0-ut1e)*(1-0,951))=0,4645
ut2e=ut2l*0,951=0,4418
letztlich ut50l=ut49e+((ut0-ut49e)*(1-0,951)=2,545
somit liegt die Gleichspannungs-
komponente dann nach 5T bei 2,5V
Abb. 3.1
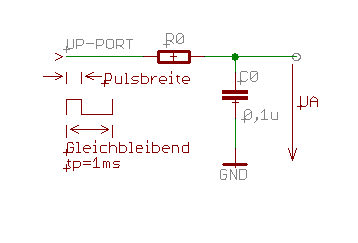
Abb.
3.2
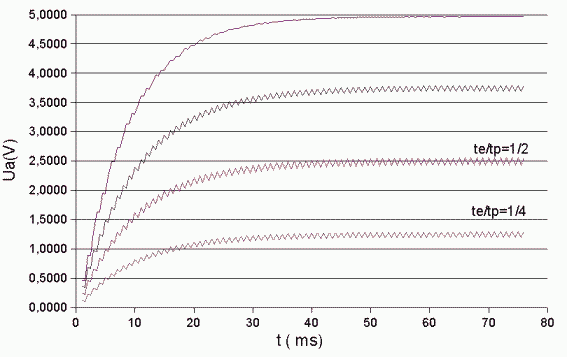
Um aber eine wesentliche Verbesserung des Ausgangssignals zu erreichen
muß man ein
mehrpoliges System, beispielsweise zwei RC-Kombinationen
mit einfacher Mitkopplung
und einer veränderbaren Impedanz, einsetzen
Abb. 3.3. Letzteres wird mit dem Op. und C3
bewirkt und soll das Überschwingen
vermindern. Die Schaltung besitzt eine wesentlich
bessere Glättung
sowie eine günstigere Dimensionierung Abb. 3.4, wobei die Koeffizienten
möglichst des Besselfilters (a1=1,3617 bi=0,4142 K=1,268)
oder Butterworthfilters
(a1=1,4142 bi=1 K=1,586) zu verwenden
sind. Quelle: Tietze-Schenk, Halbleiter-
Schaltungstechnik
Abb. 3.3
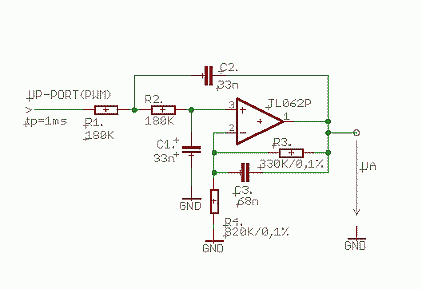
Abb.
3.4
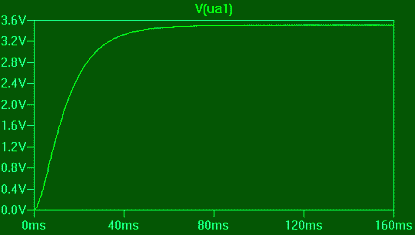

Natürlich kann man
aus der Gleichspannung das Zeitverhältnis wieder herstellen und zwar
mittels einer Abtast- Halteschaltung, einer Sägezahnspannung und eines Komparators. Letztes
vergleicht ständig die
Haltespannung mit der Sägezahnspannung. Bei überschreiten des
Spannungswerts wechselt dann der Komparator den Ausgangszustand
zum Zeitpunkt. Werden
die PWM-Signale mit einem hochfrequenten Takt verknüpft entstehen Impulsblöcke,
welche
sich dann über ein entsprechendes Filter senden und empfangen lassen. Ebenfalls läßt sich aus
dem PWM-Signal, mittels eines Zählers, wiederum ein binärer Code/Word bzw. Datenwort
erzeugen und umgekehrt.
Dabei werden die Zähler mit zusätzlichen gleichen niederfrequenten Impulsen gespeist.
Beim Sender überprüft ein Komparator den Größer- und Gleichstand mit dem Datenwort
und setzt das PWM-Sig. entsprechend bzw. erstellt die Blockdauer.
Während beim Empfänger die niederfrequenten Impulse (Baud) über die Blockdauer augezählt
werden.
Am Ende der Blockdauer muß, mit der Flanke, der Wert des Zählers in einen Speicher
übernommen
und anschließend zurückgesetzt werden.
Karl Moosbauer
Techniker f. MSR
Okt.'07